Studie über Machbarkeit, Chancen und Hemmnisse von Seilbahnen
Das Karlsruher Institut für Technologien (KIT) hat gescheiterte wie laufende Seilbahnprojekte untersucht um herauszufinden, unter welchen Bedingungen diese erfolgreich umgesetzt werden können.
„Hoch hinaus in Baden-Württemberg: Machbarkeit, Chancen und Hemmnisse urbaner Luftseilbahnen in Baden-Württemberg“ lautet der genaue Titel einer umfangreichen Arbeit des Instituts für Technikfolgenabschätzung am Karlsruher KIT. Bei einem Fachgespräch, das ich im Juli 2016 in Stuttgart unter Beteiligung des KIT durchgeführt hatte, wurden bereits Zwischenergebnisse vorgestellt. Nun liegt der rund 70 Seiten starke Abschlussbericht vor.
Die beiden Autoren der Studie, Maike Puhe und Max Reichenbach haben die Projekte in Koblenz (realisiert), Wuppertal (Planungen und Diskussion laufen) sowie Köln (gescheitert) detailliert betrachtet, indem sie mit Akteuren gesprochen haben.
Zunächst einmal stellen die Autoren fest, dass Luftseilbahnen technisch ausgereifte Systeme darstellen, die bei entsprechender Auslegung hohe und für den Stadtverkehr geeignete Beförderungsleistungen erreichen. Bis zu einer Entfernung von 10 km können Seilbahnen eine sinnvolle Alternative zu traditionellen Verkehrsmitteln wie Bus, Straßenbahn oder U‑Bahn sein. Ihre Gespräche mit Experten und ihre Analysen der näher untersuchten Planungen fassen sie so zusammen: „Alle interviewten Gesprächspartner sind sich grundsätzlich einig, dass Seilbahnen Potential im ÖV haben, jedoch kein Allheilmittel sind. Sie haben „nur einen ganz bestimmten Einsatzbereich, […] das sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen“. (…) „Die befragten Experten sind sich grundsätzlich einig, dass der Einsatz von Luftseilbahnen im öffentlichen Verkehr Potential hat. Etablierte Routinen und Verfahrensabläufe in der Verkehrsplanung stehen dem bisherigen Einsatz allerdings im Wege. Die meisten Städte verfügen bereits über ein breites Repertoire an Mobilitätsoptionen, die von Praxisakteuren zunächst als ausreichend für die Bewältigung des Verkehrsgeschehens gesehen werden. Die städtebauliche Integration von Luftseilbahnen ist ein zusätzlicher Faktor, der von Praxisakteuren als große Unsicherheit wahrgenommen wird. (…) Zwar treten manche diese Herausforderungen auch bei der Verbreitung anderer Innovationen im öffentlichen Verkehr auf. Doch bei Seilbahnvorhaben kommen einige Unsicherheiten hinzu, die es in dieser Kombination bei anderen Vorhaben nicht gibt: die Nutzung der 3. Ebene und der damit verbundene Rechtsrahmen im Umgang mit Privateigentum, das nur schwer abzuschätzende Medienecho und der mögliche Widerstand der Bevölkerung, die ausgesprochene Heterogenität der beteiligten Akteure und schließlich auch die mangelnde Erfahrung sowohl mit externen Fördermöglichkeiten als auch mit verschiedenen Betreibermodellen. Der (bisherige) Mangel an geeigneten Referenzfällen spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Die bereits genannten Vorteile von Luftseilbahnen werden wie folgt beschrieben und ergänzt (Quellenangaben hier nicht übernommen): „Dreiseil-Umlaufseilbahnen als modernstes System können bei entsprechender Auslegung laut Angaben von Seilbahnherstellern bis zu 9.000 Fahrgäste je Stunde und Richtung befördern. Solche Kapazitäten entsprechen bereits solchen, die auch von Straßenbahnsystemen erreicht werden, der Betrieb kann außerdem automatisiert und unbegleitet erfolgen. Die für eine Luftseilbahn erforderliche Infrastruktur am Boden beschränkt sich auf einzelne Masten und zwei (oder nach Bedarf auch mehrere) Stationen (…). Das hält den Bau und Betrieb von Luftseilbahnen vergleichsweise kostengünstig. Der Antrieb erfolgt stationär durch Elektromotoren, die entsprechend antriebslosen Kabinen haben ein geringes Eigengewicht und verkehren reibungsarm auf den Tragseilen, so dass der Energieverbrauch gering ist. Seilbahnen gelten als sehr sicheres und zuverlässiges Verkehrsmittel, bei denen sich kaum Unfälle und Betriebsstörungen ereignen. Stationen und Kabinen können ohne besonderen Aufwand barrierefrei gestaltet werden.“
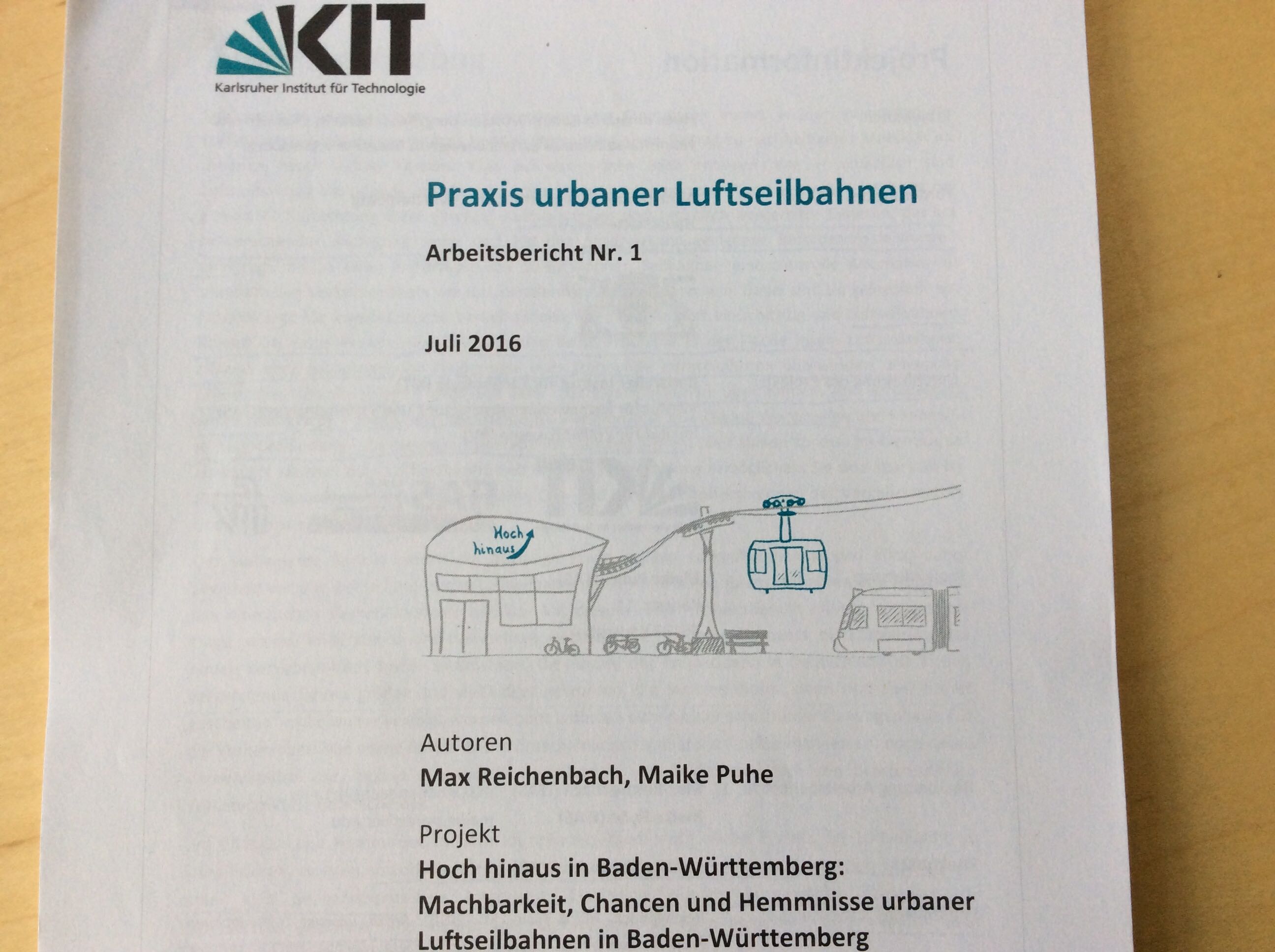 Zum Hauptproblem, dem Umgang mit Privateigentum aus der 3. Ebene heraus, empfahlen die befragten Fachleute, so viel wie möglich im öffentlichen Straßenraum zu bleiben. Von einem Ingenieurbüro wurde aber auch deutlich gemacht, dass die Frage, in welcher Höhe das Privateigentum aufhöre, „in Deutschland irgendwo mal mit einem Präzedenzfall gelöst werden“ müsse. Von den Seilbahnherstellern wurden aber auch die Möglichkeiten, die Privatsphäre zu schützen, aufgezeigt: Die Fensterscheiben der Kabinen könnten verdunkelt werden und Betroffene könnten vor herunterfallendem Müll geschützt werden.
Zum Hauptproblem, dem Umgang mit Privateigentum aus der 3. Ebene heraus, empfahlen die befragten Fachleute, so viel wie möglich im öffentlichen Straßenraum zu bleiben. Von einem Ingenieurbüro wurde aber auch deutlich gemacht, dass die Frage, in welcher Höhe das Privateigentum aufhöre, „in Deutschland irgendwo mal mit einem Präzedenzfall gelöst werden“ müsse. Von den Seilbahnherstellern wurden aber auch die Möglichkeiten, die Privatsphäre zu schützen, aufgezeigt: Die Fensterscheiben der Kabinen könnten verdunkelt werden und Betroffene könnten vor herunterfallendem Müll geschützt werden.
Insgesamt sei von enormer Bedeutung, in der Kommunikation mit der Bevölkerung fundierte und umfassende Variantenvergleiche, bei denen bei manchen Problemlagen die Seilbahn als bestmögliche Alternative übrig bleibe. Konkret heißt es dazu: „Umso wichtiger, Projekte nicht ungerahmt in den Raum zu werfen, sondern die Seilbahn als Option in soliden Variantenvergleichen zu nutzen, mit denen auf eine konkrete verkehrliche Herausforderung reagiert wird. Die vorliegende Herausforderung und der Variantenvergleich können dann Argumente liefern, warum es sich lohnt, für das Projekt einzutreten. Eng verbunden sind damit die Notwendigkeit detaillierter und transparenter Kommunikation und die geeignete Einbindung der Öffentlichkeit vom Aufkeimen der Projektidee bis zur Eröffnung der Seilbahn.“
